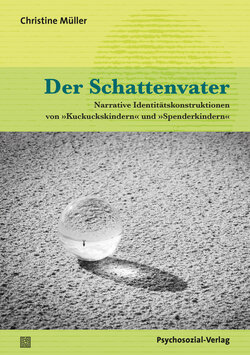ISSN: 2627-0382
388 Seiten, PDF-E-Book
Erschienen: September 2020
ISBN-13: 978-3-8379-7723-3
Bestell-Nr.: 7723
Der Schattenvater (PDF)
Sofortdownload
Dies ist ein E-Book. Unsere E-Books sind mit einem personalisierten Wasserzeichen versehen,
jedoch frei von weiteren technischen Schutzmaßnahmen (»DRM«).
Erfahren Sie hier mehr zu den Datei-Formaten.
Anhand von Interviews geht die Autorin folgenden Fragen nach: Wie wirkt sich eine verschwiegene Vaterschaft unbewusst auf das Familiensystem aus? Welche Hintergründe führten zur Aufdeckung der Wahrheit? Wie gehen Betroffene mit der Erkenntnis um, dass biologischer und sozialer Vater nicht ein und dieselbe Person sind? Wie integrieren Kinder das Wissen um den anderen Vater in ihr Leben? Welche Unterschiede zeigen sich in den Entwicklungsverläufen von Kuckucks- und Spenderkindern?
Vorwort
Wolfgang Mertens
Hinführung und Danksagung
Einleitung
1 Einführung in das Forschungsgebiet
1.1 »Kuckuckskind«
1.1.1 Begriffsklärung und rechtlicher Kontext
1.1.2 Statistische Häufigkeit des Vorkommens von Kuckuckskindern
1.1.3 Forschung zu Kuckuckskindern
1.2 »Spenderkind«
1.2.1 Geschichte, Verfahren, Recht und ethische Gedanken
1.2.2 Statistische Häufigkeit des Vorkommens von Spenderkindern
1.2.3 Forschung zu Spenderkindern
1.3 Erste Fragen und Überlegungen
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Identität – Ich – Selbst
2.1.1 Philosophische Theorien zur Entwicklung des Ich
2.1.2 Sozialwissenschaftliche Theorien zur Entwicklung des Ich
2.1.3 Entwicklungspsychologische Theorien zur Entwicklung des Selbst
2.1.4 Neurowissenschaftliche Theorien zur Entstehung des Bewusstseins
2.1.5 Psychoanalytische Theorien zur Entwicklung des Ich
2.2 Affekt und Abwehr
2.2.1 Hass
2.2.2 Scham
2.2.3 Schuld
2.2.4 Neid
2.2.5 Abwehr
2.3 Bedeutung der sozialen Umgebung für die individuelle Entwicklung
2.3.1 Mütterlichkeit und Funktionen der Mutter für die kindliche Entwicklung
2.3.2 Vaterschaft und Funktionen des Vaters für die kindliche Entwicklung
2.3.3 Funktion des Vaters als »Drittem« und andere Formen der Triangulierung
3 Empirischer Teil
3.1 Forschungsrahmen
3.2 Fragestellung und Zielsetzung
3.3 Design der Studie
3.3.1 Psychoanalyse und qualitative Forschung
3.3.2 Das narrative Interview
3.3.3 Das narrative Interview im Projekt
3.3.4 Beschreibung der Datengrundlage
3.4 Methode der Datenverwaltung
3.4.1 Qualitative Datenanalyse (QDA) mittels MAXQDA
3.4.2 Grounded Theory
3.4.3 Praktisches Arbeiten mit dem Kategorie-System von MAXQDA
4 Methodenteil
4.1 Rekonstruktion narrativer Identität (RNI)
4.1.1 Dimensionen narrativer Identität
4.1.2 Grundprinzipien der Textinterpretation
4.1.3 Die Schritte der Textanalyse
4.2 Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD)
4.2.1 Beziehung
4.2.2 Struktur
4.2.3 Konflikt
4.3 Psychoanalytische Hermeneutik
5 Ergebnisteil
5.1 Ergebnisse der quantitativen Analyse
5.1.1 Soziodemografische Merkmale der Personengruppen
5.1.2 Sozioökonomische Merkmale der Personengruppen
5.2 Ergebnisse der Rekonstruktion narrativer Identität (RNI)
5.2.1 Zeitpunkt, Beteiligte und Folgen der Aufklärung
5.2.2 Objektrepräsentanz der Mutter
5.2.3 Objektrepräsentanz des sozialen Vaters
5.2.4 Objektrepräsentanz des biologischen Vaters
5.2.5 Objektbeziehungsrepräsentanz der Eltern
5.2.6 Selbstrepräsentanz und Selbstpositionierung
5.2.7 Identitätssicherheit, Identitätsunsicherheit, Identitätsverlust
5.2.8 Aufbau des Narrativs
5.3 Ergebnisse der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD)
5.3.1 Beziehung
5.3.2 Konflikt
5.3.3 Struktur
5.4 Ergebnisse psychoanalytischer Hermeneutik
5.4.1 Übertragung und Gegenübertragung
5.4.2 Affekte
5.4.3 Abwehr
6 Schlussbetrachtungen
6.1 Limitationen der Studie
6.2 Diskussion
6.3 Implikationen für Forschung und Praxis
Literatur
Anhang: Transkriptionsregeln
»Angesichts der im Aufwind begriffenen genetischen Forschung, die es ermöglicht, eine Vaterschaft eindeutig zu belegen, hat sich das öffentliche Interesse an den sogenannten ›Kuckuckskindern‹, also Kindern, die in ›gutem Glauben‹ von einem nicht-biologischen Vater großgezogen werden, verstärkt. Um dem dahingehenden Forschungsdesiderat Rechnung zu tragen, beschäftigt sich diese Dissertation aus dem Fach der Psychologie mit der Rekonstruktion der narrativen Identität dieser Kinder. (...) Im Gesamten ein wichtiger Beitrag zur Grundlagenforschung für den Bereich der ›Kuckucks- und Spenderkinder‹ und zu einer wissenschaftlich informierten gesellschaftlichen Diskussion der gewählten Thematik ...«
, DZI. Soziale Arbeit. Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, 1.2022
»Bemerkenswert in dem Buch fand ich, dass beide Gruppen [Kuckucks- und Spenderkinder] bei den Befragungen angegeben hatten, dass sie gerne Kenntnisse über ihren biologischen Vater hätten, dass der soziale Vater aber eine ebenso bedeutsame Rolle spielt. Insgesamt beinhaltet das Buch eine Untersuchung über ein bisher wenig erforschtes Thema. Gerade vor dem Hintergrund erweiterter Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin und dem Aufbrechen traditioneller Familienbilder – Spenderanonymität versus Recht des Kindes auf Kenntnis der Herkunft – eine interessante Ausarbeitung ...«
Jürgen Döllmann, kath-maennerarbeit.de
»Die analytische Psychotherapeutin Christine Müller geht anhand von Interviews der Frage nach, welche Folgen es für die Identität der betroffenen Kinder hat, ›Kuckucks-‹ oder ›Spenderkinder‹ zu sein. Dabei beleuchtet sie auch die Rolle der sozialen Umgebung für die individuelle Entwicklung ...«
, Netz. Zeitschrift für Pflege- und Adoptivkinder Schweiz Nr. 2, 2020
»Durch akribische Auswertung von 16 autobiografischen Erzählungen analysiert Müller, wie sich die meist spät in Erfahrung gebrachten Verwandtschaftsverhältnisse von ›Kuckucks-‹ und Spenderkindern auf ihr subjektives Selbstverständnis und soziales Gefüge auswirken. Während der theoretische Teil mit vielseitigen Thesen zur Bildung und Funktion von Identität, Emotion und sozialem Umfeld besticht, bietet der empirisch-methodische Teil einige interessante Einblicke in die Methoden der qualitativen Sozialforschung. Die übersichtlich bebilderten Darstellungen und Detail-Analysen der Interview-Situationen bergen lesenswerte, authentische Momente, deren psychologische Einordnung wohl jede*n an der einen oder anderen Stelle persönlich berühren ...«
Theresa Roy, GID Gen-ethischer Informationsdienst Nr. 257 – Mai 2021
»Dies ist eine ansprechende Arbeit mit einer klaren Struktur. Die vorliegenden Methoden und Empirie sind nachvollziehbar, die Forschungslage ausführlich dargelegt. Dabei berücksichtigt die Autorin auch den Forschungskontext über biologische und soziale Elternschaft. Es gibt Ansätze dazu, wie die beiden Gruppen die Konstruktion ihrer Selbstidentität und Abwehrstrategien vornehmen und was die psychischen Folgen sind. Obwohl es individuelle Schicksale sind, können sie zu einigen allgemeingültigen Aussagen zusammengefasst werden ...«
Michael Lausberg, Scharf links. Die ›neue‹ linke online Zeitung, 2. Januar 2021