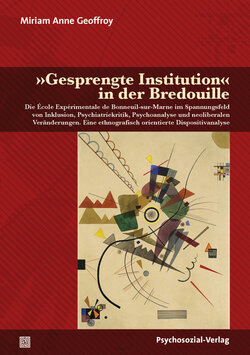Buchreihe: Forschung Psychosozial
708 Seiten, PDF-E-Book
1. Aufl. 2019
Erschienen: Mai 2019
ISBN-13: 978-3-8379-7465-2
Bestell-Nr.: 7465
708 Seiten, PDF-E-Book
1. Aufl. 2019
Erschienen: Mai 2019
ISBN-13: 978-3-8379-7465-2
Bestell-Nr.: 7465
»Gesprengte Institution« in der Bredouille (PDF)
Die École Expérimentale de Bonneuil-sur-Marne im Spannungsfeld von Inklusion, Psychiatriekritik, Psychoanalyse und neoliberalen Veränderungen. Eine ethnografisch orientierte Dispositivanalyse
Sofortdownload
Dies ist ein E-Book. Unsere E-Books sind mit einem personalisierten Wasserzeichen versehen,
jedoch frei von weiteren technischen Schutzmaßnahmen (»DRM«).
Erfahren Sie hier mehr zu den Datei-Formaten.
Neoliberale sozio-ökonomische und politische Transformationen seit den 1990er Jahren haben gravierende Auswirkungen auf pädagogische und therapeutische Institutionen. Diese Auswirkungen arbeitet Miriam Anne Geoffroy in ihrer Darstellung einer bislang in Deutschland noch kaum bekannten inklusiven psychoanalytisch-pädagogischen Einrichtung heraus: der École Expérimentale de Bonneuil-sur-Marne, gegründet 1969 bei Paris von Maud Mannoni. Sie beleuchtet dabei die emanzipatorischen Ansätze sowie die theoretischen und historischen Hintergründe der antipsychiatrisch und psychoanalytisch (lacanianisch) orientierten »gesprengten Institution«, die psychoanalytische Theorien über zwischenmenschliche Beziehungen auf institutionelle Strukturen überträgt. Auf Basis einer ethnografisch orientierten Dispositivanalyse verdeutlicht die Autorin, wie neue Finanzierungssysteme, Evaluationen, flexiblere Arbeitszeiten, Sicherheitsdiskurse und andere Faktoren die Einrichtung zunehmend in die Bredouille geraten ließen, wie die Handlungsmöglichkeiten immer mehr eingeschränkt wurden und mit welchen Widersprüchen die Einrichtung konfrontiert war. Zugleich zeigt sie, welche innovativen Impulse ›Bonneuil‹ unter anderem für die psychologische und pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen – auch in Deutschland – bis heute liefern kann.
Geleitwort
1 Ein ›Ort zum Fragen‹
1.1 Was ist »Bonneuil«? Und was heißt es für die »gesprengte Institution«, in der Bredouille zu sein?
1.2 Aufbau der Arbeit
1.3 Forschung in und um Bonneuil herum
2 Eine ethnografisch orientierte Dispositivanalyse
2.1 Ethnografischer Zugang
2.1.1 Ein/mein Weg nach Bonneuil
2.1.2 Zwischen Bonneuil und dem Schreibtisch: mein Kommen und Gehen, mein ›Fort-Da‹
2.1.3 »Was zum Teufel geht denn hier ab?«: Ethnografischer Blick und teilnehmende Beobachtung als eine Notwendigkeit für die »gesprengte Institution«
2.1.4 ›Expert_innen‹-Interviews
2.2 Das heterogene Material
2.3 Dispositivanalyse
2.3.1 Mein Forschungsgegenstand als Dispositiv
2.3.2 Eine Dispositivanalyse ohne ›Küchenrezept‹?
2.4 Das Potential einer ethnografisch orientierten Dispositivanalyse
3 »Gesprengte Institution«: Historischer Kontext, Struktur, Konzept und Praxis
3.1 Ein »Ort zum Leben«: Die École Expérimentale und der historische Kontext ihrer Gründung
3.1.1 Die Gründungsgeschichte
3.1.2 Der Alltag in und außerhalb von Bonneuil
3.1.2.1 Die Kinder und Jugendlichen
3.1.2.2 Die ›Equipe des soignants‹
3.1.2.2.1 Die ›Permanents‹
3.1.2.2.2 Die Praktikant_innen
3.1.2.3 Die Tagesklinik
3.1.2.3.1 Der Unterricht
3.1.2.3.2 Die ›Causette‹
3.1.2.3.3 Die ›Zwischenräume‹
3.1.2.3.4 Die ›Ateliers‹
3.1.2.3.5 Die Versammlungen
3.1.2.3.6 Die Leitung
3.1.2.3.7 Die Finanzierung
3.1.2.4 Die Orte außerhalb der École
3.1.3 Der Einfluss der Antipsychiatrie und anderer alternativer psychiatrischer Ansätze
3.1.3.1 Ausländische Einflüsse aus England und Italien
3.1.3.2 Reformbewegungen der französischen Psychiatrie
3.1.3.2.1 Die »Psychiatrie de secteur«
3.1.3.2.2 Die »Psychothérapie institutionnelle« und Bonneuil
3.1.3.2.2.1 Die Entstehungsgeschichte
3.1.3.2.2.2 Die 1950er Jahre
3.1.3.2.2.3 Die Institution als Mittel der Therapie
3.1.3.2.2.4 Psychoanalyse und Institution
3.1.3.2.2.5 Die Institution als Ort und Form des Austausches
3.1.3.2.2.6 Die Zerschlagung des totalitären Charakters von Institutionen
3.1.3.2.2.7 Die Übertragung und der Kontext
3.2 Die »gesprengte Institution«
3.2.1 Psychoanalytische Grundlagen
3.2.1.1 Das »Fort-Da-Spiel« nach Freud
3.2.1.2 Die Lacan’sche Psychoanalyse
3.2.1.2.1 Lacans Rezeption in anderen Ländern und Sprachen
3.2.1.2.2 Wesentliche Merkmale der Lacan’schen Psychoanalyse
3.2.1.2.3 Das »Imaginäre«
3.2.1.2.3.1 Das »Spiegelstadium«
3.2.1.2.3.2 Die Ordnung des »Imaginären«
3.2.1.2.4 Die »Symbolische Ordnung«
3.2.1.2.4.1 Die Verschränkung des Symbolischen und des Imaginären: Die Bedeutung des Anderen bzw. der Sprache für die Bildung des Imaginären
3.2.1.2.4.2 Die Rolle des Signifikanten
3.2.1.2.4.3 Das »Fort-Da-Spiel« als ursprüngliche Symbolisierung
3.2.1.2.4.4 Exkurs:Winnicotts »Übergangsobjekt« und »Übergangsphänomen«
3.2.1.2.4.5 Das »Désir« und die Kastration
3.2.1.2.4.6 Der »Phallus« und die Kastration
3.2.1.2.4.7 Exkurs: Judith Butlers Kritik an Lacan
3.2.1.2.4.8 Wesentliche Aspekte der »väterlichenMetapher«
3.2.1.2.4.9 Der »Name-des-Vaters« und das Unbewusste
3.2.1.2.4.10 Die »Forclusion«
3.2.1.2.4.11 Das »Reale«
3.2.1.2.4.12 Zusammenfassung: Das ›Symbolische‹ und das ›Imaginäre‹
3.2.1.3 Maud Mannoni
3.2.1.3.1 Biografie
3.2.1.3.2 Wesentliche Merkmale ihrer Arbeit
3.2.1.3.3 »Das zurückgebliebene Kind und seine Mutter«
3.2.1.3.4 Mannoni und Bettelheim
3.2.1.3.5 »Der Psychiater, sein Patient und die Psychoanalyse«
3.2.1.3.6 Keine psychoanalytischen Sitzungen in der Institution
3.2.2 Das Konzept der »gesprengten Institution«
3.2.3 Die Praxis der »gesprengten Institution«
3.2.2.1 Keine Abschaffung, sondern Sprengung der Institution
3.2.2.2 Entschleierung von pathologisierenden und sklerotisierenden Funktionen
3.2.2.3 Die »gesprengte Institution« als »Fort-Da-Spiel«
3.2.2.4 Das »Recht auf Risiko«
3.2.2.5 Ein Platz in Bonneuil – Ein Platz im Symbolischen
3.2.3 Die Praxis der »gesprengten Institution«
3.2.3.1 Die Orte außerhalb der École
3.2.3.1.1 Die »Familles d’accueil en province«
3.2.3.1.2 Die »camps de vacances«
3.2.3.1.3 Die »Lieux d’accueil de nuit«
3.2.3.1.4 Die »Travail à l’extérieur«
3.2.3.1.5 Die Sitzungen bei den Analytiker_innen
3.2.3.2 Der Unterricht
3.2.3.2.1 Lesen, Schreiben und Rechnen
3.2.3.2.2 Ein anderes Lernen
3.2.3.2.3 Die »Compagnons«
3.2.3.2.4 Prüfungen
3.2.3.2.5 Die Fernschule
3.2.3.3 Die »Ateliers«
4 Theoretische Ansätze zur Analyse der »Gesprengten Institution«
4.1 Bio-Macht
4.1.1 Disziplin
4.1.2 Regulierung der Bevölkerung
4.1.3 Disziplin und Bio-Politik
4.1.4 Exkurs: Theorie der Degeneration
4.2 Neoliberale Gouvernementalität
4.2.1 Gouvernementalität
4.2.2 Einige Kennzeichen des Liberalismus und des Wohlfahrtsstaates
4.2.3 Der Neoliberalismus
4.2.4 Der neue Risikobegriff
4.2.5 Neoliberale Diskurse und Praktiken
4.3 Evaluation als Exklusionsmittel und als ›disziplinäre Standardisierung im Neoliberalismus‹
4.4 Überschneidungen von einigen Idealen und Forderungen der ›68er‹ mit Diskursen und Anforderungen des neoliberalen Kapitalismus
4.5 ›Selbstbestimmtes Leben‹ als ›neoliberale Pflicht‹
4.6 Stärken und Schwächen des Gouvernementalitätsansatzes bei der Analyse Sozialer Arbeit
4.7 Gegen-Verhalten und Widerstand im Neoliberalismus
4.8 Diskurs der Macht–Diskurs der Kritik
4.9 Schlussfolgerungen aus den theoretischen Ansätzen
5 »Gesprengte Institution« in der Bredouille
5.1 Die Finanzierung Bonneuils und ihre Schwierigkeiten
5.1.1 Die »Vernichtungsmaschine«: Finanzierungsprobleme von Anfang an
5.1.2 »Le prix de journée«
5.1.3 Finanzierung der Gastfamilien in den 70er und 80er Jahren
5.1.4 »La Dotation globale de financement«
5.1.5 Die 35-Stunden-Woche
5.1.6 Zusammenfassung
5.2 Akkreditierung und Evaluation
5.2.1 Der Plan Juppé
5.2.2 Ursprünge der Akkreditierung
5.2.3 Definition und Ziele der Akkreditierung
5.2.4 Die ANAES und die Akkreditierungshandbücher
5.2.5 Die Akkreditierung im Rahmen von ökonomischen, politischen und Sicherheitsinteressen
5.2.6 Zwischeninterpretation
5.2.7 Kooperation mit anderen Verfahren
5.2.8 Zwischeninterpretation
5.2.9 Richtlinien, Referenzpunkte und Kriterien der Akkreditierung
5.2.10 Die Richtlinien im Akkreditierungshandbuch von 1999
5.2.11 Die Richtlinien im Akkreditierungshandbuch von 2004
5.2.12 Zwischeninterpretation
5.2.13 Die Etappen des Akkreditierungsverfahrens
5.2.13.1 Antrag auf Beteiligung am Akkreditierungsverfahren
5.2.13.2 Eintritt in das Akkreditierungsverfahren
5.2.13.3 Autoevaluation
5.2.13.4 Kontrollbesuch
5.2.13.5 Schlussfolgerung des »Collège de l’accréditation«
5.2.13.6 Mitteilung und Veröffentlichung der Ergebnisse
5.2.13.7 Zwischeninterpretation
5.2.14 Schlussfolgerungen
5.3 Der Rechenschaftsbericht über die Akkreditierung Bonneuils und einige Folgen für die Praxis
5.3.1 Teil 1 des Rechenschaftsberichtes: Standardisierte Vorstellung der Einrichtung
5.3.2 Teil 2 des Rechenschaftsberichtes: Zeitliche Abwicklung des Akkreditierungsverfahrens
5.3.3 Teil 3 des Rechenschaftsberichtes: Beurteilungen und abschließende Entscheidungen
5.3.3.1 Zusammenfassung der Beurteilungen
5.3.3.2 Abschließende Entscheidungen und Verbesserungsempfehlungen
5.3.4 Schlussfolgerungen
5.4 Veränderungen und Schwierigkeiten im Team
5.4.1 Der Tod Maud Mannonis
5.4.1.1 Administrative Veränderungen innerhalb von Bonneuil nach Mannonis Tod
5.4.1.2 Der Verlust von Mannonis zentraler Rolle im Team und ihrer einmaligen Funktion nach außen
5.4.1.3 Schwierige Trauer
5.4.1.4 Diskussionen um die Zukunft Bonneuils in den ersten zwei Jahren nach Mannonis Tod
5.4.2 Generationenkonflikte und unterschiedliche soziale Positionen
5.4.2.1 Die ›68er-Mitarbeiter_innen‹
5.4.2.2 Mitarbeiter_innen der jüngeren Generation
5.4.2.2.1 Andere Arbeitsbedingungen und soziale Positionen
5.4.2.2.2 Anderes Verhältnis zur Arbeit: Kontrolle der Arbeitszeit und Trennung von Privatem und Beruflichem
5.4.2.2.3 Suche nach beruflicher Sicherheit und Sicherheitsdiskurse
5.4.2.3 Die soziale Situation der Praktikant_innen
5.4.3 Verbreitung von ›erzieherischen‹ und autoritären Praktiken
5.4.3.1 Keine ›Entkonditionierung‹ mehr?
5.4.3.2 Die Ausbildung der Jüngeren und die veränderte Rolle der Psychoanalyse
5.4.3.3 Mimetisches Lernen oder mimetisches Ver-Lernen
5.4.4 Verlust der kollektiven Verantwortung
5.4.4.1 Zunehmende Arbeitsteilung und Hierarchisierungen
5.4.4.2 Angst vor Anzeigen und ein realer Torriegel
5.4.4.3 Angst um den Arbeitsplatz und Neid breiten sich aus
5.4.4.4 Verlust der Freude an der Arbeit, Kontrolle und ›Verpetzen‹ der Kolleg_innen
5.4.4.5 Personalisierung und Psychologisierung von Problemen
5.4.4.6 Zersplitterung und Individualisierung der Mitarbeiter_innen
5.4.4.7 Zusammenfassung
5.4.5 Meinungsverschiedenheiten und Widersprüche im Rahmen der Vorbereitung des ersten Akkreditierungsdurchganges in Bonneuil
5.4.6 Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Krisen
5.4.7 Unzureichende Reflektion über die Bedeutung des Hauttons
5.4.8 Meine veränderte Rolle als Forscherin
5.5 Umstrukturierungen und Veränderungen im Alltag
5.5.1 Verkürzungen der Ferienlager
5.5.2 Zersplitterung und andere Veränderungen des Wochenenddienstes
5.5.3 Abschaffung der Garderoben
5.5.4 Einführung von Anwesenheitslisten
5.6 Schule als Normalisierungsdispositiv?
5.7 Architektur und Platzierung im geografischen Raum als nachhaltige strukturelle Widerstände?
5.8 Anzahl und Gruppengrößen der Kinder und Jugendlichen
5.9 Und nach Bonneuil: Selbstbestimmte Armut?
5.10 Internationaler Solidaritätsaufruf von 2012 – Une page se tourne: Ein Kapitel schließt sich, ein neues beginnt
6 Sprengung der dualen Geschlechterkonstruktion? Ein Ausblick
6.1 Geschlechterkonstruierende Diskurse in Bonneuil
6.2 Die Rolle des Inzesttabus in Bonneuil
6.3 Jenseits von Lacans dualem Weltbild
7 Resümee: Bonneuil als Modell?
7.1 Eine außerordentliche ›Erfindung‹
7.2 »Gesprengte Institution« mit und in Schwierigkeiten
7.3 Von Bonneuil nach Deutschland: Zur Relevanz der Erkenntnisse für die Psychologie und Pädagogik diesseits des Rheins
Nachwort
Danksagung
Literatur
Abkürzungen
1 Ein ›Ort zum Fragen‹
1.1 Was ist »Bonneuil«? Und was heißt es für die »gesprengte Institution«, in der Bredouille zu sein?
1.2 Aufbau der Arbeit
1.3 Forschung in und um Bonneuil herum
2 Eine ethnografisch orientierte Dispositivanalyse
2.1 Ethnografischer Zugang
2.1.1 Ein/mein Weg nach Bonneuil
2.1.2 Zwischen Bonneuil und dem Schreibtisch: mein Kommen und Gehen, mein ›Fort-Da‹
2.1.3 »Was zum Teufel geht denn hier ab?«: Ethnografischer Blick und teilnehmende Beobachtung als eine Notwendigkeit für die »gesprengte Institution«
2.1.4 ›Expert_innen‹-Interviews
2.2 Das heterogene Material
2.3 Dispositivanalyse
2.3.1 Mein Forschungsgegenstand als Dispositiv
2.3.2 Eine Dispositivanalyse ohne ›Küchenrezept‹?
2.4 Das Potential einer ethnografisch orientierten Dispositivanalyse
3 »Gesprengte Institution«: Historischer Kontext, Struktur, Konzept und Praxis
3.1 Ein »Ort zum Leben«: Die École Expérimentale und der historische Kontext ihrer Gründung
3.1.1 Die Gründungsgeschichte
3.1.2 Der Alltag in und außerhalb von Bonneuil
3.1.2.1 Die Kinder und Jugendlichen
3.1.2.2 Die ›Equipe des soignants‹
3.1.2.2.1 Die ›Permanents‹
3.1.2.2.2 Die Praktikant_innen
3.1.2.3 Die Tagesklinik
3.1.2.3.1 Der Unterricht
3.1.2.3.2 Die ›Causette‹
3.1.2.3.3 Die ›Zwischenräume‹
3.1.2.3.4 Die ›Ateliers‹
3.1.2.3.5 Die Versammlungen
3.1.2.3.6 Die Leitung
3.1.2.3.7 Die Finanzierung
3.1.2.4 Die Orte außerhalb der École
3.1.3 Der Einfluss der Antipsychiatrie und anderer alternativer psychiatrischer Ansätze
3.1.3.1 Ausländische Einflüsse aus England und Italien
3.1.3.2 Reformbewegungen der französischen Psychiatrie
3.1.3.2.1 Die »Psychiatrie de secteur«
3.1.3.2.2 Die »Psychothérapie institutionnelle« und Bonneuil
3.1.3.2.2.1 Die Entstehungsgeschichte
3.1.3.2.2.2 Die 1950er Jahre
3.1.3.2.2.3 Die Institution als Mittel der Therapie
3.1.3.2.2.4 Psychoanalyse und Institution
3.1.3.2.2.5 Die Institution als Ort und Form des Austausches
3.1.3.2.2.6 Die Zerschlagung des totalitären Charakters von Institutionen
3.1.3.2.2.7 Die Übertragung und der Kontext
3.2 Die »gesprengte Institution«
3.2.1 Psychoanalytische Grundlagen
3.2.1.1 Das »Fort-Da-Spiel« nach Freud
3.2.1.2 Die Lacan’sche Psychoanalyse
3.2.1.2.1 Lacans Rezeption in anderen Ländern und Sprachen
3.2.1.2.2 Wesentliche Merkmale der Lacan’schen Psychoanalyse
3.2.1.2.3 Das »Imaginäre«
3.2.1.2.3.1 Das »Spiegelstadium«
3.2.1.2.3.2 Die Ordnung des »Imaginären«
3.2.1.2.4 Die »Symbolische Ordnung«
3.2.1.2.4.1 Die Verschränkung des Symbolischen und des Imaginären: Die Bedeutung des Anderen bzw. der Sprache für die Bildung des Imaginären
3.2.1.2.4.2 Die Rolle des Signifikanten
3.2.1.2.4.3 Das »Fort-Da-Spiel« als ursprüngliche Symbolisierung
3.2.1.2.4.4 Exkurs:Winnicotts »Übergangsobjekt« und »Übergangsphänomen«
3.2.1.2.4.5 Das »Désir« und die Kastration
3.2.1.2.4.6 Der »Phallus« und die Kastration
3.2.1.2.4.7 Exkurs: Judith Butlers Kritik an Lacan
3.2.1.2.4.8 Wesentliche Aspekte der »väterlichenMetapher«
3.2.1.2.4.9 Der »Name-des-Vaters« und das Unbewusste
3.2.1.2.4.10 Die »Forclusion«
3.2.1.2.4.11 Das »Reale«
3.2.1.2.4.12 Zusammenfassung: Das ›Symbolische‹ und das ›Imaginäre‹
3.2.1.3 Maud Mannoni
3.2.1.3.1 Biografie
3.2.1.3.2 Wesentliche Merkmale ihrer Arbeit
3.2.1.3.3 »Das zurückgebliebene Kind und seine Mutter«
3.2.1.3.4 Mannoni und Bettelheim
3.2.1.3.5 »Der Psychiater, sein Patient und die Psychoanalyse«
3.2.1.3.6 Keine psychoanalytischen Sitzungen in der Institution
3.2.2 Das Konzept der »gesprengten Institution«
3.2.3 Die Praxis der »gesprengten Institution«
3.2.2.1 Keine Abschaffung, sondern Sprengung der Institution
3.2.2.2 Entschleierung von pathologisierenden und sklerotisierenden Funktionen
3.2.2.3 Die »gesprengte Institution« als »Fort-Da-Spiel«
3.2.2.4 Das »Recht auf Risiko«
3.2.2.5 Ein Platz in Bonneuil – Ein Platz im Symbolischen
3.2.3 Die Praxis der »gesprengten Institution«
3.2.3.1 Die Orte außerhalb der École
3.2.3.1.1 Die »Familles d’accueil en province«
3.2.3.1.2 Die »camps de vacances«
3.2.3.1.3 Die »Lieux d’accueil de nuit«
3.2.3.1.4 Die »Travail à l’extérieur«
3.2.3.1.5 Die Sitzungen bei den Analytiker_innen
3.2.3.2 Der Unterricht
3.2.3.2.1 Lesen, Schreiben und Rechnen
3.2.3.2.2 Ein anderes Lernen
3.2.3.2.3 Die »Compagnons«
3.2.3.2.4 Prüfungen
3.2.3.2.5 Die Fernschule
3.2.3.3 Die »Ateliers«
4 Theoretische Ansätze zur Analyse der »Gesprengten Institution«
4.1 Bio-Macht
4.1.1 Disziplin
4.1.2 Regulierung der Bevölkerung
4.1.3 Disziplin und Bio-Politik
4.1.4 Exkurs: Theorie der Degeneration
4.2 Neoliberale Gouvernementalität
4.2.1 Gouvernementalität
4.2.2 Einige Kennzeichen des Liberalismus und des Wohlfahrtsstaates
4.2.3 Der Neoliberalismus
4.2.4 Der neue Risikobegriff
4.2.5 Neoliberale Diskurse und Praktiken
4.3 Evaluation als Exklusionsmittel und als ›disziplinäre Standardisierung im Neoliberalismus‹
4.4 Überschneidungen von einigen Idealen und Forderungen der ›68er‹ mit Diskursen und Anforderungen des neoliberalen Kapitalismus
4.5 ›Selbstbestimmtes Leben‹ als ›neoliberale Pflicht‹
4.6 Stärken und Schwächen des Gouvernementalitätsansatzes bei der Analyse Sozialer Arbeit
4.7 Gegen-Verhalten und Widerstand im Neoliberalismus
4.8 Diskurs der Macht–Diskurs der Kritik
4.9 Schlussfolgerungen aus den theoretischen Ansätzen
5 »Gesprengte Institution« in der Bredouille
5.1 Die Finanzierung Bonneuils und ihre Schwierigkeiten
5.1.1 Die »Vernichtungsmaschine«: Finanzierungsprobleme von Anfang an
5.1.2 »Le prix de journée«
5.1.3 Finanzierung der Gastfamilien in den 70er und 80er Jahren
5.1.4 »La Dotation globale de financement«
5.1.5 Die 35-Stunden-Woche
5.1.6 Zusammenfassung
5.2 Akkreditierung und Evaluation
5.2.1 Der Plan Juppé
5.2.2 Ursprünge der Akkreditierung
5.2.3 Definition und Ziele der Akkreditierung
5.2.4 Die ANAES und die Akkreditierungshandbücher
5.2.5 Die Akkreditierung im Rahmen von ökonomischen, politischen und Sicherheitsinteressen
5.2.6 Zwischeninterpretation
5.2.7 Kooperation mit anderen Verfahren
5.2.8 Zwischeninterpretation
5.2.9 Richtlinien, Referenzpunkte und Kriterien der Akkreditierung
5.2.10 Die Richtlinien im Akkreditierungshandbuch von 1999
5.2.11 Die Richtlinien im Akkreditierungshandbuch von 2004
5.2.12 Zwischeninterpretation
5.2.13 Die Etappen des Akkreditierungsverfahrens
5.2.13.1 Antrag auf Beteiligung am Akkreditierungsverfahren
5.2.13.2 Eintritt in das Akkreditierungsverfahren
5.2.13.3 Autoevaluation
5.2.13.4 Kontrollbesuch
5.2.13.5 Schlussfolgerung des »Collège de l’accréditation«
5.2.13.6 Mitteilung und Veröffentlichung der Ergebnisse
5.2.13.7 Zwischeninterpretation
5.2.14 Schlussfolgerungen
5.3 Der Rechenschaftsbericht über die Akkreditierung Bonneuils und einige Folgen für die Praxis
5.3.1 Teil 1 des Rechenschaftsberichtes: Standardisierte Vorstellung der Einrichtung
5.3.2 Teil 2 des Rechenschaftsberichtes: Zeitliche Abwicklung des Akkreditierungsverfahrens
5.3.3 Teil 3 des Rechenschaftsberichtes: Beurteilungen und abschließende Entscheidungen
5.3.3.1 Zusammenfassung der Beurteilungen
5.3.3.2 Abschließende Entscheidungen und Verbesserungsempfehlungen
5.3.4 Schlussfolgerungen
5.4 Veränderungen und Schwierigkeiten im Team
5.4.1 Der Tod Maud Mannonis
5.4.1.1 Administrative Veränderungen innerhalb von Bonneuil nach Mannonis Tod
5.4.1.2 Der Verlust von Mannonis zentraler Rolle im Team und ihrer einmaligen Funktion nach außen
5.4.1.3 Schwierige Trauer
5.4.1.4 Diskussionen um die Zukunft Bonneuils in den ersten zwei Jahren nach Mannonis Tod
5.4.2 Generationenkonflikte und unterschiedliche soziale Positionen
5.4.2.1 Die ›68er-Mitarbeiter_innen‹
5.4.2.2 Mitarbeiter_innen der jüngeren Generation
5.4.2.2.1 Andere Arbeitsbedingungen und soziale Positionen
5.4.2.2.2 Anderes Verhältnis zur Arbeit: Kontrolle der Arbeitszeit und Trennung von Privatem und Beruflichem
5.4.2.2.3 Suche nach beruflicher Sicherheit und Sicherheitsdiskurse
5.4.2.3 Die soziale Situation der Praktikant_innen
5.4.3 Verbreitung von ›erzieherischen‹ und autoritären Praktiken
5.4.3.1 Keine ›Entkonditionierung‹ mehr?
5.4.3.2 Die Ausbildung der Jüngeren und die veränderte Rolle der Psychoanalyse
5.4.3.3 Mimetisches Lernen oder mimetisches Ver-Lernen
5.4.4 Verlust der kollektiven Verantwortung
5.4.4.1 Zunehmende Arbeitsteilung und Hierarchisierungen
5.4.4.2 Angst vor Anzeigen und ein realer Torriegel
5.4.4.3 Angst um den Arbeitsplatz und Neid breiten sich aus
5.4.4.4 Verlust der Freude an der Arbeit, Kontrolle und ›Verpetzen‹ der Kolleg_innen
5.4.4.5 Personalisierung und Psychologisierung von Problemen
5.4.4.6 Zersplitterung und Individualisierung der Mitarbeiter_innen
5.4.4.7 Zusammenfassung
5.4.5 Meinungsverschiedenheiten und Widersprüche im Rahmen der Vorbereitung des ersten Akkreditierungsdurchganges in Bonneuil
5.4.6 Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Krisen
5.4.7 Unzureichende Reflektion über die Bedeutung des Hauttons
5.4.8 Meine veränderte Rolle als Forscherin
5.5 Umstrukturierungen und Veränderungen im Alltag
5.5.1 Verkürzungen der Ferienlager
5.5.2 Zersplitterung und andere Veränderungen des Wochenenddienstes
5.5.3 Abschaffung der Garderoben
5.5.4 Einführung von Anwesenheitslisten
5.6 Schule als Normalisierungsdispositiv?
5.7 Architektur und Platzierung im geografischen Raum als nachhaltige strukturelle Widerstände?
5.8 Anzahl und Gruppengrößen der Kinder und Jugendlichen
5.9 Und nach Bonneuil: Selbstbestimmte Armut?
5.10 Internationaler Solidaritätsaufruf von 2012 – Une page se tourne: Ein Kapitel schließt sich, ein neues beginnt
6 Sprengung der dualen Geschlechterkonstruktion? Ein Ausblick
6.1 Geschlechterkonstruierende Diskurse in Bonneuil
6.2 Die Rolle des Inzesttabus in Bonneuil
6.3 Jenseits von Lacans dualem Weltbild
7 Resümee: Bonneuil als Modell?
7.1 Eine außerordentliche ›Erfindung‹
7.2 »Gesprengte Institution« mit und in Schwierigkeiten
7.3 Von Bonneuil nach Deutschland: Zur Relevanz der Erkenntnisse für die Psychologie und Pädagogik diesseits des Rheins
Nachwort
Danksagung
Literatur
Abkürzungen